Vom Viertel zum Territorium: Das Modell der Brüder Cherchi | Olianas

Menschen
Vom Viertel zum Territorium: Das Modell der Brüder Cherchi
von Jessica Cani
Wenn man die Brüder Cherchi trifft, ist es nicht ungewöhnlich, dass man anhält, um zu plaudern – oder noch besser, um Käse zu probieren. Wer sie schon lange kennt, erkennt schnell, dass hinter ihren Projekten, bei denen Käse zusammen mit viel Forschung im Mittelpunkt steht, die Werte Familie, Vertrauen und Dienst am Viertel stehen: die drei Säulen, die in dreißig Jahren einen kleinen Nachbarschaftsladen in ein tägliches Qualitätslabor verwandelt haben.

In den 1980er-Jahren war die Familie Cherchi eine Einverdienerfamilie: Der Vater war Angestellter, die Mutter Hausfrau. 1984 zog die Familie von Quartucciu nach Selargius. Die Kinder waren vier: Fabrizio, Michele, Corrado und Alice.
Sie wuchsen mit einer einfachen Lektion auf: lernen zu verkaufen. Mit dem Großvater mit dem Fahrrad Trauben und Feigen pflücken oder die Ware auf der kleinen Waage wiegen gehörte zu ihrer Kindheit, ebenso wie die Treue zu denen, die gute Arbeit leisten. Immer derselbe Metzger, immer derselbe Gemüsehändler mit dem kleinen Laster – Loyalität war zu Hause üblich.
1997 kam die Wende. Es gab einen Nachbarschaftsladen zu übernehmen. Michele studierte Politikwissenschaft, Fabrizio war als Zeitsoldat im letzten Dienstjahr – sie erbten keinen Beruf, sie bauten ihn auf, unterstützt vom Vater, der einen Teil seiner Abfindung vorstreckte, und von einer Bank, die zuhören wollte.
Ihre erste Entscheidung spiegelte bereits ihre Vorstellung vom Handel wider: die Öffnungszeiten ändern. Früh öffnen, spät schließen, die bisher unversorgten Zeitfenster abdecken. Zwischen 13:00 und 14:30 Uhr erreichten sie Arbeiter, Doppelverdienerpaare und alle, die ein schnelles und gutes Mittagessen suchten. Aus diesem Zeitfenster entstand eine Kundschaft und eine Identität: Service als Kern des Projekts.
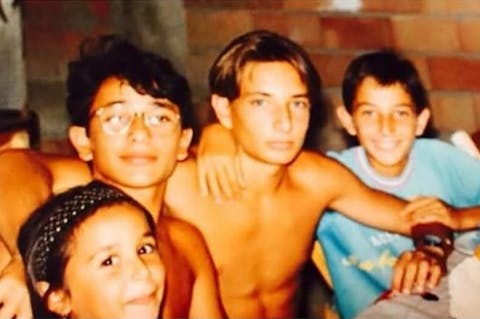
2001 kam der große Schritt: ein größerer Laden, längere Regale, steigende Nachfrage. Der Laden wuchs, ebenso das Team – nicht durch die Einstellung von Profis, sondern mit einer einfachen und unkonventionellen Idee: Menschen ausbilden, denn Kompetenz kann man lernen, die Einstellung zum Service nicht.
Die Rekrutierung war fast lokal: Jugendliche, die vorbeikamen, um zu helfen, Geschwister von bestehenden Mitarbeitern, bekannte Gesichter aus dem Viertel, die zu Kollegen wurden. Es ist eine langfristige Investition, aufgebaut auf Mentoring, Fehlern und geteilten Verantwortlichkeiten. „Wenn man nur Professionalität einstellt, riskiert man, einen Titel zu kaufen und das Team zu verlieren“, geben sie zu, denn das Team ist nicht nur eine Ansammlung von Fähigkeiten, sondern gemeinsame Zeit.
In dieser Philosophie liegt die symbolische Geschichte von Andrea. Zunächst war er langjähriger, vertrauenswürdiger Brotzulieferer, und als die Bäckerei schloss, trat er dem Team bei – eine natürliche Fortsetzung der bestehenden Beziehung. „Andrea und ich kannten uns schon vor der Eröffnung: eine Lieferbeziehung in Zusammenarbeit umzuwandeln war fast automatisch.“

So halten die Cherchis in der Stadt ein Viertelskonzept aufrecht, das anderswo oft verloren geht: langanhaltende Beziehungen, ständige Präsenz und Verantwortung, die in beide Richtungen fließt. Die tägliche Arbeit folgt derselben Logik: Arbeitspläne angepasst an die Lebensrhythmen, kontinuierliche interne Schulungen (Schneiden, Lagerung, Produktpräsentation) und ständiger Austausch zwischen Theke und Küche.
Das Ergebnis ist ein Team, das mit Komplexität umgehen kann: Wer an der Theke steht, kennt die Rohstoffe genauso gut wie diejenigen, die sie in der Küche verarbeiten, und wer am Tisch serviert, kann dem Kunden die Arbeit hinter den Regalen vermitteln. Im Mittelpunkt steht das Verständnis, dass Qualität kein individueller Akt ist, sondern ein Ökosystem: Lieferanten als Partner, Kollegen aus der eigenen Ausbildung und Kunden, die wiederkommen, weil sie dieses unausgesprochene Abkommen erkennen.
Dieses Konzept setzt sich im Marktstand von San Benedetto (jetzt auf den Piazza Nazzari verlegt), in der Salsamenteria, dem 2017 eröffneten Laden, und im Bistrot am Poetto fort, in dem Alice in der Küche stand, das kürzlich geschlossen wurde. „Ich habe viel gelernt, und es war eine Möglichkeit herauszufinden, was ich wirklich tun wollte. Wir haben enorm viel gelernt, besonders im Management, und es hat Spaß gemacht. Aber alles hat seinen Zyklus, und der Zyklus des Bistrots war beendet.“

Die akribische Suche nach dem richtigen Produkt kam nicht sofort, war aber immer von Interesse. Eines Tages geschah ein Ereignis, das alles veränderte. Michele erinnert sich genau an die Szene. Eine Dame stand vor einem Käsebrett, auf dem auch ein Stilton, ein englischer Blauschimmelkäse, lag, und fragte: „Aus welcher Milch ist der gemacht?“ „Ich sagte spontan, es sei Schafsmilch“, erinnert er sich. „Dann, während ich sie bediente, bekam ich Zweifel und zu Hause überprüfte ich es, um sicherzugehen, dass ich mich nicht blamiert hatte. Nun… ich hatte mich blamiert, es war tatsächlich Kuhmilch.“
Diese Frage wurde zum Schalter. „Wir erkannten, dass es nicht reicht, nur ein schickes Produkt anzubieten: Wenn man es nicht erklären kann, bewegt man es nur von einem Regal zum anderen.“ Das war der Beginn ihrer Entscheidung, sich weiterzubilden.
Autodidaktisch, ja, aber mit Methode. Handbücher, gezielte Verkostungen, Besuche in Käsereien. Und vor allem: Kurse nach Sardinien bringen, die es dort noch nicht gab, und sie für Produzenten und Enthusiasten öffnen. „Bildung wurde unser Weg, Wert zurückzugeben: Was wir lernen, setzen wir wieder in Umlauf.“
Auch Reisen bekamen eine neue Bedeutung: Messen, die früher ignoriert wurden, wurden zu Orten des Austauschs. Käsemessen wurden zu Freiluftlaboren. „Wir gehen hin, um uns von Sicherheiten zu lösen“, sagt Michele. „Wir kehren mit besseren Fragen und ein paar mehr Antworten zurück.“ Inzwischen wurde eine strukturelle Grenze am Tresen deutlich.
„In Sardinien erzählen wir wenig über unsere wirkliche Vielfalt.“ Außerhalb der Insel kennt man uns für Pecorino, und selten gibt es eine Erzählung, die alle Sorten hervorhebt; innerhalb arbeitet jeder für sich. Doch die Insel ist ein Mosaik: Ziege in Regionen mit sauberer Säure; Kuh im zentral-nördlichen Gebiet mit Pasta-filata-Käsen (perette, paneddas, casizolu) und präzisen Techniken; Schaf in vielen Varianten von Weide und Saison. Echte Unterschiede, nicht replizierbar. Der Punkt ist, sie in Reihe zu bringen. Ein gemeinsamer Wortschatz und ein einheitlicher Auftritt auf Messen, um das Ganze vor den Einzelteilen zu zeigen: Konsortien, Verbände, mit einer Stimme sprechen und dann jedem Produzenten erlauben, seine eigene Note zu spielen.

In dreißig Jahren haben die Brüder Cherchi nicht nur ein Geschäft aufgebaut, sondern ein Modell unternehmerischer Nachhaltigkeit, das den üblichen Expansionslogiken widerspricht. „Wir haben versucht, uns zu verändern, indem wir das Abendgeschäft übernommen haben, aber wir merkten, dass es wirtschaftlich nicht tragfähig war.“
Nachhaltigkeit bedeutet für die Cherchis nicht nur Bilanzen, sondern menschliches Gleichgewicht. „Es gab Tage, an denen ich von 7 Uhr morgens auf dem Markt bis 21 Uhr gearbeitet habe. Aber wofür? Und wie lange kann ich das durchhalten?“ Diese Frage leitete ihre strategischen Entscheidungen und führte dazu, dass sie die Servicequalität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter über den unmittelbaren Umsatz stellen.
Alberto, ihr Koch, arbeitet seit sechs Jahren bei ihnen – ein „Rekord“, gerade weil er hier nachhaltige Arbeitsbedingungen gefunden hat. „Für uns ist es wichtig, Menschen in die Lage zu versetzen, zu bleiben, was bedeutet, ihr Leben planen zu können“, erklären sie. „Du kannst nicht nur für mich arbeiten, und ich sage das seit COVID: Die Zukunft der Gastronomie ist Service“, fügt Michele hinzu.
Diese Vision hat sie der Versuchung unkontrollierter Expansion widerstehen lassen. „Man sagt: Lass uns 10 Filialen eröffnen, okay. Aber werden diese 10 denselben Service- und Qualitätsstandard haben? Unmöglich“, reflektieren sie und stellen fest, dass viele erfolgreiche Unternehmen an Qualität verlieren, wenn sie zu schnell wachsen. Ihre Nachhaltigkeit zeigt sich auch in der familiären Führung.
Auf die Frage, was es bedeutet, mit Geschwistern zu arbeiten, lachen sie und scherzen, dann bestätigen sie: „Eine Sache haben wir nie getan: Wir haben nie wegen Geld gestritten.“ Sie haben zu viele Familien durch wirtschaftliche Streitigkeiten zerstört gesehen und sich für einen anderen Weg entschieden: „Manche verlieren einen Bruder wegen vier Ziegeln, aber warum sollte es mich kümmern?“
Mit Blick auf die Zukunft sehen die Cherchis Diversifizierung nicht als Expansion, sondern als natürliche Entwicklung: „Wir haben begonnen zu diversifizieren, also ist es klar, auch an die Zeit zu denken, in der wir physisch nicht mehr mithalten können.“ Ausbildung wird zentral für ihre Projekte, und sie setzen die pädagogische Berufung fort, die sie schon immer ausgezeichnet hat, wenn es darum geht, Käse und ihr Territorium zu vermitteln.
Ihre Lehre ist klar: Unternehmerische Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, wirtschaftlich zu überleben, sondern ein Modell zu schaffen, das Menschen respektiert, Qualität bewahrt und langfristig denkt.

Zu den frustrierendsten Momenten, erzählen sie, gehörte vor einigen Jahren die Messe Cheese in Bra, die internationale Käsemesse: „Jahrelang existierte die Region Sardinien nicht. Sie war nicht da. Sie war abwesend.“ Als endlich ein institutioneller Stand erschien, verhielten sich die sardischen Produzenten selbstschädigend: „Alle Produzenten achteten darauf, Abstand zueinander zu halten. Wenn sie nah beieinander standen, verkaufte der Nachbar mehr als er.“
Diese Mentalität der mentalen statt geografischen Isolation bekämpfen die Cherchis jeden Tag. „Isolation ist ein Geisteszustand“, reflektieren sie und beobachten, wie andere Regionen sich geschlossen präsentieren: „Sieh dir die Wirkung der Garfagnana an. Es war eine einzige Stimme, die eine Vielzahl von Produkten repräsentierte. Das Territorium ist es, das verkauft.“
Ihr Kampf, Netzwerke zu schaffen, beginnt von unten, Produzent für Produzent. „Wenn Produzenten ihre Arbeit sichtbar machen wollen, müssen sie sich zusammenschließen, denn zehn Stimmen sind lauter als eine.“ In ihren Köpfen entsteht ein konkreter Traum: „Ich möchte eine Käse-Straße in Sardinien. Touren zu den Käseproduzenten selbst.“
Eine Route, die kleine exzellente Betriebe auf der Insel verbindet, die „paradoxerweise immer fantastische Orte sind“. Samuel Lai mit seinen Sinnos, Geronimo Sanna in Samugheo, Agnese und Giacomo mit ihrem modernen Ansatz in Ozieri, Giuseppe Cugusi mit seinem Fiore Sardo in Fordongianus, Pietro Ragaglia mit seiner Antica Caresi. „Wir können diversifizieren, wir können kleinen Produzenten helfen, die eine Hand brauchen“, träumen die Cherchis.
Aber es braucht einen Mentalitätswechsel: Produzenten müssen lernen, sich zu erzählen, Institutionen müssen ein System bilden, und Verbraucher müssen den Schatz entdecken, der direkt vor ihrer Haustür liegt. Frankreich hat es geschafft, indem es die Namen der Städte in ikonische Käsesorten verwandelte: Camembert, Roquefort. „Den Namen mit dem Produkt zu verbinden war der entscheidende Schritt“, beobachten sie. Sardinien hat alles, um diesen Erfolg zu wiederholen: Es braucht nur Mut und eine gemeinsame Vision.

