Federico Esu: der Architekt der Verbindungen, der Sardinien wiederaufbaut | Olianas

Menschen
Federico Esu: der Architekt der Verbindungen, der Sardinien wiederaufbaut
von Jessica Cani
Federico Esu verkörpert die Brücke, die er schon immer bauen wollte: zur Hälfte Sarde, zur Hälfte Sizilianer, aufgewachsen in einem Carbonia, das für sich genommen bereits ein Labor kultureller Vermischungen war. Aus diesem doppelten Erbe – der Großvater, ein Hirte aus Barbusi, und die sizilianischen Großeltern, die die Insel als Heimat wählten – entwickelte er eine Perspektive, die in der Lage ist, verschiedene Welten zu erfassen und wieder miteinander zu verbinden.
Geboren in Iglesias und aufgewachsen in Carbonia, atmete Federico schon in seiner Kindheit die Essenz eines Landes mit gemischten Wurzeln ein. „Carbonia war der perfekte Schmelztiegel: keine traditionelle Kleidung, kein ‚unser‘ Gericht, sondern eine unglaubliche kulturelle Mischung“, erinnert er sich. Diese Identitätenmischung prägte seine Weltanschauung und seine Fähigkeit, Chancen über die Grenzen hinaus zu erkennen.
Seine Wurzeln liegen in zwei sich ergänzenden Bereichen. Die väterliche Seite verband ihn mit dem tiefen Sardinien: „Meine Großeltern aus Barbusi sprachen Sardisch, mein Spielplatz war ein ganzer Berg; Kaninchen, Hühner, Onkel Silvano, wie ihn alle nannten. Als Junge aus Carbonia war ich von dieser agrarisch-pastoralen Welt fasziniert.“ Die mütterliche Seite hingegen erzählte ihm von Mobilität: „Meine sizilianischen Großeltern kamen in ihren Zwanzigern, verbrachten sogar eine Zeit in Turin bei Fiat, dann entschieden sie sich, zurückzukehren, weil die Insel mittlerweile Heimat geworden war.“
Aus diesem doppelten Blickwinkel entstand sein Drang zu erkunden. Nach der Schule zog er nach Cagliari und wählte Jura, angezogen vom internationalen Recht. „Die Grenzen von Carbonia reichten nicht; ich fühlte, dass ich noch nicht die Mittel hatte, um die Ideen in meinem Kopf umzusetzen“, gesteht er. Die juristische Praxis in der Anwaltskammer von Cagliari ließ ihn erkennen, dass die Robe nicht sein Schicksal war. „Ich erkannte, dass ich wirklich Sprachen und unterschiedliche Kulturen liebte. Wegzugehen war kein Fluchtakt, sondern pure Neugier – mit einer Prise kreativer Wut: Ich wollte sehen, was sonst noch für mich da draußen war, jenseits der Insel.“
Das Erasmus-Programm in Glasgow wurde seine erste Öffnung zu einer größeren Welt, gefolgt von einem Master in London dank des Stipendiums Master and Back.

Für Federico war Brüssel weniger eine Stadt als eine berufliche Chance: „Ich bin gekommen, weil ich die Europäische Kommission wollte: Für mich war Brüssel Arbeit, nicht die Stadt.“ Acht einhalb Jahre im Herzen der europäischen Institutionen wurden zu einem Labor, um Fähigkeiten und Vision zu verfeinern.
Vom Rechtsexperten entwickelte er sich zum Projektmanager und leitete Vereinbarungen über Innovation und Technologie, fühlte jedoch den Bedarf an einem solideren theoretischen Fundament. So begann er ein Abend-MBA an der Bocconi, pendelte regelmäßig zwischen Brüssel und Mailand – ein Pendeln, das paradoxerweise die Verbindung zu Italien wiederherstellte und Gedanken an eine mögliche Rückkehr entfachte.
Die Pandemie beschleunigte diese Überlegung und verwandelte Brüssel in eine unkenntliche Stadt: „Die Pandemie hat meine Bezugspunkte weggeblasen: Freunde gingen, Donnerstagsessen verschwanden, Coworking-Spaces schlossen.“ Die „Expat-Blase“, die zuvor abenteuerlich erschien, wirkte nun wie ein schwebendes Aquarium, weit entfernt von einer echten Gemeinschaft.

Es war während des Lockdowns, dass Itaca entstand, ein handgefertigtes Projekt, das zum Kompass für seine Rückkehr werden sollte. „Welches Werkzeug habe ich hier und jetzt, um Menschen zusammenzubringen? Einen Podcast“, fragte sich Federico, eingeschlossen in seiner Wohnung in Belgien. Mit einem Einstiegs-Mikrofon und einem als Schallabsorber aufgehängten Laken begann er, Gespräche aufzuzeichnen, die über Lebensläufe hinausgingen.
Die erste Stimme gehörte einem Freund, den er in London kennengelernt hatte: „Es ist die perfekte Geschichte: beginnt als Spüler, studiert nachts, leitet heute eine Abteilung bei Lloyd’s.“ Federico suchte keine berühmten Talente, sondern Menschen, die bereit waren, ihre Geschichten authentisch zu erzählen. Als sich das Interviewprojekt entwickelte, bemerkte er, dass eine entscheidende Perspektive fehlte: „Es fehlte die Linse der Rückkehrer. Also richtete ich den Fokus auf Dialoge zwischen denen, die gehen, und denen, die bleiben.“ Es entstanden Brückenfolgen, die scheinbar weit entfernte Welten verbanden.
Der Podcast offenbarte unerwartete Kraft: Zuhörer begannen, sich gegenseitig zu schreiben, Kontakte auszutauschen und ein spontanes Netzwerk gegenseitiger Unterstützung zu schaffen. „Irgendwann fand ich mich in einem WhatsApp-Chat mit 70 Namen von Vancouver bis Villacidro wieder: Sie tauschten Kontakte, Stipendien, sogar Mietwohnungen aus.“ Itaca zeigte, dass es nicht nur um Storytelling geht, sondern um eine Plattform für emotionale und berufliche Solidarität.

Das Vertrauen, das die Teilnehmer von Itaca ihm entgegenbrachten, überzeugte Federico, dass das Projekt mehr als nur ein Podcast war – es war ein sozialer Flickenteppich. „Diese Gespräche haben die Kraft, ein Gewebe in Sardinien zu reparieren, das sich gelockert hat, weil wir aufgehört haben zu kommunizieren“, bemerkt er.
Auch die Entscheidung, nach Sardinien zurückzukehren, entstand aus diesen Gesprächen, jedoch nicht sofort. Während eines Vorstellungsgesprächs bei einem neuen Arbeitgeber fragte Federico, ob er nach Italien zurückkehren könne. Die Antwort kam prompt: „Perfekt, wir haben ein Büro in Bologna.“ Er entgegnete: „Bologna ist wunderbar, aber ich würde es gerne von Sardinien aus machen.“ Ein kurzer Moment der Überraschung am anderen Ende, dann Offenheit: „Wir finden einen Weg.“
Die Entscheidung reifte in privaten Gesprächen mit Sophie, seiner belgischen Partnerin: Wochen des Abwägens – „Bleiben wir in Brüssel? Gehen wir nach Madrid, vielleicht in die Schweiz?“ – bis fast gleichzeitig die richtige Frage auftauchte: „Warum nicht Cagliari? Hier gibt es eine Welle von Rückkehrern und Projekte, die gerade starten.“
Heute lächelt Federico, wenn er daran zurückdenkt: „Die Werkzeuge, die mir mit zwanzig fehlten, habe ich jetzt. Und ich habe erkannt, dass ich nicht alle Zutaten selbst haben muss: Es reicht, die richtigen Menschen zu haben, um Alchemie zu schaffen. Wenn es klappt, wird es außergewöhnlich; wenn nicht, haben wir es zumindest zur richtigen Zeit versucht.“

Federicos Rückkehr nach Sardinien Ende 2023 setzte eine außergewöhnliche Energie frei. „In achtzehn Monaten habe ich mehr Projekte umgesetzt als in den fünf Jahren zuvor“, erzählt er. Aus dieser Dynamik entstand Nodi, ein Dachprojekt, das verschiedene Initiativen vereint: den Podcast Itaca, mobile Workshops, Schulbesuche und ein Mentoring-Programm.
„Sardinien braucht nicht noch einen ‚zurückkehrenden Genius‘; es braucht Verbindungen“, betont er. Sein Beitrag konzentriert sich darauf, Menschen und Ideen zu vernetzen, Situationen aus der Vogelperspektive zu sehen und selbst ein einfaches Aperitif-Treffen in einen potenziellen Katalysator für kulturellen Wandel zu verwandeln.
Federico spricht mit Klarheit über Verantwortung: „Wenn man das Privileg hatte, wegzugehen, zu studieren und mit neuen Fähigkeiten zurückzukehren, muss man diese der Gemeinschaft zur Verfügung stellen.“ Dieser Gedanke zeigt sich in einem Mentoring-Programm, bei dem Experten zu „großen Geschwistern“ für jene werden, die Führung suchen, und Fragen statt fertiger Antworten anbieten.
Nodis Vision ist ambitioniert, aber pragmatisch: „Das Ziel ist, Sardinien auf dieselbe Waage zu stellen wie Mailand oder London.“ Heute, so Federico, ist ein gut bezahltes Angebot außerhalb der Insel oft zehnmal so attraktiv wie ein Wagnis in Sardinien. Nodi arbeitet daran, diese Ungleichheit auszugleichen, damit Gehen oder Bleiben freie Entscheidungen sind, keine Notwendigkeit.
Die ersten Ergebnisse sind bereits sichtbar, wie etwa die Gruppe von „kleinen Knoten“, die sich zuvor nur virtuell kannten und einen ganzen Sonntag in London damit verbrachten, über Projekte für Sardinien zu sprechen. Es ist der Beweis, dass das Netzwerk funktioniert und Verbindungen neue Verbindungen schaffen.
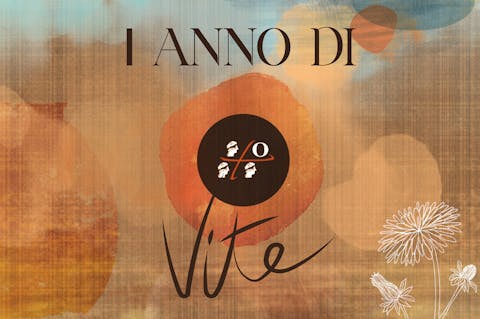
Mit der Geschichte von Federico Esu erreichen wir das erste Jahr von Vite: zwölf Termine für zwölf Persönlichkeiten, die auf ihre Weise die Insel neu gestalten. Es ist kein Zufall, dass er der letzte Gast ist, denn mit ihm gestalten wir das erste Vite-Event.
Um dieses erste Jahr des Erzählens zu feiern, haben wir uns entschieden, zu den Ursprüngen zurückzukehren, zwischen den Reben der Tenuta Olianas.
Am Samstag, den 24. Mai, zeitgleich mit Cantine Aperte, werden Tenuta Olianas, Jessica Cani—die treibende Kraft hinter Vite und Netzwerkerin im Bereich Essen und Wein—und Federico Esu, in seiner Rolle als Talente-Vermittler auf der Insel, einige der im Verlauf des Projekts interviewten Gäste zusammenbringen, ergänzt durch neue Stimmen.
Die Details der Veranstaltung folgen in Kürze, aber eines können Sie bereits tun: markieren Sie das Datum im Kalender. Am 24. Mai stoßen wir gemeinsam auf ein Jahr Vite und auf die Verbindungen, die weiter wachsen: Gespräche, Getränke, Essen und gemeinsames Beisammensein.
